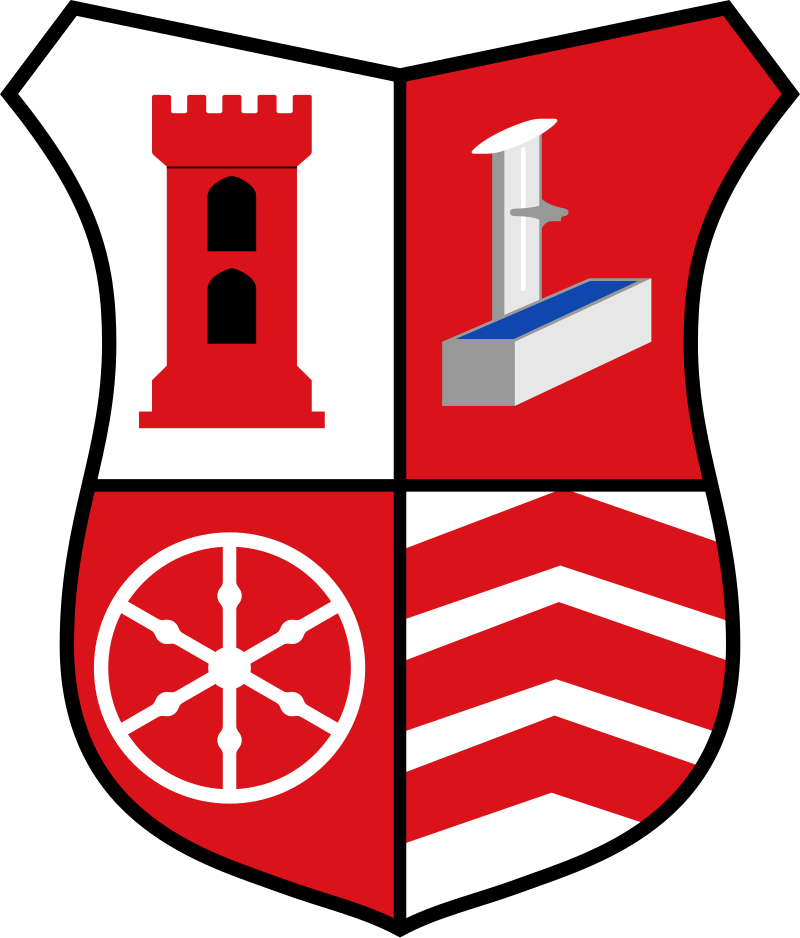Älteste Funde
Die ältesten Funde rund um Schloßborn stammen aus keltischer Zeit. Die größte keltische Siedlung in unserer Gegend ist das Heidetränk Oppidum oberhalb von Oberursel. Diese keltische Stadt stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Die keltischen Ringwälle auf dem Altkönig sind noch etwa 100 Jahre älter und auch auf dem Schloßborner Hausberg, dem Butznickel soll es keltische Ringwälle aus dieser Zeit gegeben haben. Jedenfalls hat sie dort der Historiker Karl August von Cohausen, Anfang des 20. Jahrhunderts, noch entdecken können.
Römischer Limes um Schloßborn
Um das Jahr 85 nach Christus vertrieben die Römer, die in unserer Gegend seit etwa 10 n. Chr. sesshaft gewordenen Chatten und es entstand der Obergermanisch-Raetische Limes, der schon in frühester Zeit die nördliche Grenze der Schloßborner Einflusszone darstellte.
Alamannische Expansion
Nach der Aufgabe des Limes um 260 n. Chr. und dem Rückzug der Römer auf linksrheinische Gebiete, kamen die Alamannen in unsere Region, die dann wiederum durch die Franken ab dem 4. Jahrhundert nach Süden abgedrängt wurden.
Fränkische Zeit
Nach dem Sieg über die Alamannen im Jahr 496, konvertierte Frankenkönig Chlodwig zum römisch-katholischen Glauben.
Ausdehnung des fränkischen Reichs
Sigibert, ein Enkel des Chlodwig, König von Austrasien, heiratete 566 Brunichild, eine Tochter des Westgotenkönigs Athanagild. Nach der heimtückischen Ermordung Sigiberts durch Fredegunde, eine Zweitfrau und ehemalige Konkubine von Sigiberts Halbbruder Chilperich, und einem Bündnis mit Guntram von Burgund, übernahm Brunichild die Macht in Austrasien, zudem auch die Gegend um den Feldberg und Schloßborn gehörte. Nach vielen Machtkämpfen wurde sie 613 von ihren Gegnern gefangengenommen und hingerichtet.
„Lectulus Brunihilde“
Die Brunhilde, von der im Text der Bardo-Urkunde, der Ersterwähnungsurkunde Schloßborns aus dem Jahre 1043, die Rede ist, kann unmöglich die Brunhilde der Nibelungensage sein, da das Nibelungenlied erst um 1250, also etwa 250 Jahre später, aufgeschrieben wurde. Vielmehr handelt es sich bei unserer „Brunihilde“ mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die Frankenkönigin Brunichild, von der es sogar heißt, dass sie des Öfteren den Feldberg besuchte, um von hier oben ihr Reich zu überblicken.
Sage von Nixe und Mönch an Quelle
Die Zeit der echten Brunichild, also die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts, ist auch die Zeit der iro-schottischen Mönche im Taunus, also der ersten Missionierungsversuche der Bevölkerung. Eine Sage aus dieser Zeit berichtet für Schloßborn von einem Kloster auf dem Butznickel. Vorstellbar wäre das durchaus, wenn vielleicht auch nicht auf dem Butznickel, sondern vielleicht als Vorgängerbau der ersten Willigis-Kirche von 985 direkt im heutigen Schloßborn, oder auf einer Geländeerhöhung vor den Toren Schloßborns, die von altersher „Christenhöhe“ genannt wird. Da wir aus der Bardo-Urkunde wissen, dass es noch um 1043, hier in unserer Gegend, keine Siedlung außer „Brunnon“, das heutige Schloßborn, gab, ist es sogar vorstellbar, dass die berühmte Frankenkönigin auf ihren Wegen zum Feldberg, hier im Kloster oder einer Einsiedelei übernachtete.
Willigis
Was also führte zu der Entscheidung des Reichskanzlers und Erzbischofs von Mainz, Willigis, genau hier in Schloßborn, die erste Kirche des Taunus zu errichten? War es vielleicht ein Kloster als Vorgängerbau? Wir wissen es nicht, denn in der einzigen Urkunde, die uns davon berichtet, der Bardo-Urkunde aus 1043, ist darüber nichts verzeichnet. Aber sehr viele andere Informationen über die damalige Zeit, für unsere Gegend, sind dort beschrieben und sind es wert, dass wir sie hier genau beleuchten.
Doch wer war denn dieser Willigis überhaupt?
- Geboren etwa 940
- Entstammte einer niedersächsischen Kaufmanns- oder Großbauernfamilie, kein Adel!
- Wurde 969 durch seinen Förderer „Folkold von Meissen“ an den Hof Otto des Großen geholt
- Wurde 971 von Otto dem Großen zum Erzkanzler gemacht
- Blieb unter Otto dem II. Kanzler und wurde 975 zum Erzbischof von Mainz ernannt. Wurde damit zum Stellvertreter des Papstes und höchstem Kirchenvertreter nördlich der Alpen.
- Als Otto II. 983 in Italien verstarb, sorgte Willigis durch sein beherztes Auftreten für dessen 3-jährigen Sohn, dessen Krönung Willigis an Weihnachten 983 in Aachen gerade noch vollzogen hatte, dafür, dass das Kind Otto III. König blieb und sich gegen Heinrich den Zänker durchsetzen konnte.
- Willigis sorgte dafür, dass Theophanu, Frau von Otto II. und Mutter Otto III., bis zur Mündigkeit ihres Sohnes, als Kaiserin das Reich regierte. Leider verstarb sie schon im Juni 991, als ihr Sohn gerade 11 Jahre alt war.
- Willigis sorgte nun dafür, dass Kaiserin Adelheid, Königin von Italien, die letzte Frau von Otto dem Großen und Großmutter Otto III., bis zur Mündigkeit von Otto III. im Jahr 994, das Reich regierte.
- Willigis war in dieser Zeit der beiden Kaiserinnen Kanzler und wichtigster Ratgeber.
- In den letzten Regierungsjahren Otto III. überwarf sich Willigis mit Otto und machte nach dessen Tod im Jahr 1002, Heinrich II., einen Sohn von Heinrich dem Zänker, zum König.
- Willigis sorgte dafür, dass Papst Gregor V., Bruno von Kärnten, ein Urenkel Otto des Großen und Schüler des Willigis, 996 mit 24 Jahren zum ersten deutschen Papst erhoben wurde.
- Willigis ließ ab 975 den ersten Mainzer Dom errichten, der noch in seinem Beisein, im Jahr 1009, bei seiner feierlichen Einweihung und Illumination abbrannte.
- Außerdem errichtete Willigis die Kirche St. Stephan, als seine Grabeskirche, die heute mit Marc Chagalls Fenstern, immer noch, hoch über Mainz thront.
- Willigis verstarb, hochbetagt und hochverehrt am 23. Februar 1011
Bardo-Urkunde von 1043 (Ersterwähnung Schloßborns) und der Sprengel von Schloßborn
Und außerdem ließ er hier in Schloßborn, im Jahr 985, die erste Kirche des Taunus, eine Holzkirche errichten und stattete diese Kirche mit Privilegien, z.B. dem Zehntrecht aus.
Der von Willigis festgelegte Sprengel der Kirche von Schloßborn begann an der Weilquelle, führte an der Weil entlang durch das heutige Niederreifenberg in Richtung Schmitten, dort bis nach Dorfweil und dann den damals Schönweil genannten Bachlauf nach Arnoldshain hinauf bis zum Sandplacken, von dort zum Gipfel des Feldbergs, samt dem schon erwähnten „Bettchen der Brunhilde“, von dort über die heutige Abbiegung „Eselsheck“ über Stein- und Eichkopf am Silberbach (damals Bouchbach genannt) entlang bis Ehlhalten. Von dort dem Schwarzbach (damals Cruoftera genannt) entlang über Vockenhausen bis Eppstein, dann der Theis (damals Duosna) genannt über Bremthal, Niedernhausen und Königshofen bis zu ihrem Quellgebiet bei Engenhahn folgend, dort auf den Limes (Pfohl genannt) stoßend. Dem Limes über Nieder- und Oberseelbach und Lenzhahn zum Limeskastell Altenburg folgend, dann an Schloßborn und dem noch lange nicht existierenden Glashütten vorbei, zurück zur Weilquelle am Roten Kreuz.
Die Verwaltung und z.B. auch das Eintreiben der Steuern im Sprengel von Schloßborn wurde an die Kanoniker, die Brüder von St. Stephan zu Mainz übertragen. Dafür hatten alle Einwohner des Sprengels das Recht, in Schloßborn zur Kirche zu gehen, sich hier taufen zu lassen, hier zu heiraten und beerdigt zu werden.
Der Name Schloßborn taucht im Zusammenspiel mit Willigis und seinem Wirken im Zusammenhang mit dem Ausbau von Verwaltungsstrukturen auf dem Lande, im frühen Mittelalter, in Publikationen führender deutscher Historiker, u.a. auch von Michael Hollmann, dem Präsidenten des Bundesarchivs Koblenz, immer wieder auf.
Erzbischof Bardo
Erzbischof Bardo, der genau wie Willigis auch Reichskanzler, nur eben unter Heinrich III. war, ließ im Jahr 1043 die ganzen Geschehnisse rund um Willigis, den Sprengel Schloßborns und auch den Bau und die Weihe der ersten Holzkirche im Jahr 985, in der s.g. Bardo-Urkunde, dessen Original in der Heidelberger Universitätsbibliothek liegt, aufschreiben.
„Staggo, Bischof der Dänen“
Und ein äußerst interessanter Aspekt, ein besonders interessanter Hinweis, versteckt sich in der Beschreibung der Person des Bischofs, der die Holzkirche im Jahr 985 in Schloßborn weihte. Wie wir wissen, war Willigis mit Kaiserin Theophanu auf Antrittsreise im Reich unterwegs und er schickte deshalb einen Vertreter namens „Staggo“, den Bischof der Dänen. Doch wie kam es dazu?
Schlacht bei Crotone/Kalabrien
Am 15. Juli 982 verlor Kaiser Otto II. die Schlacht am Kap Colonna bei Crotone gegen die Sarazenen. Obwohl der Anführer der Sarazenen fiel und sich Otto über das Meer retten konnte, wurde Ottos Streitmacht nahezu vollständig vernichtet. Die Verluste betrugen etwa 4000 Mann, darunter über 2000 seiner besten Panzerreiter (die Ritter der damaligen Zeit). Von dieser Niederlage erholte sich Otto nie mehr. Er berief für Mai 983 einen Reichstag in Verona ein, bei dem auch Willigis teilnahm.
Nach dem Reichstag verließ Willigis zusammen mit dem 3-jährigen Sohn Ottos II. Italien in Richtung Aachen, wo er Otto III. an Weihnachten 983 zum König krönte. Die Nachricht vom Tod Otto II. traf bei den Krönungsfeierlichkeiten ein, die abrupt beendet waren.
Durch die Niederlage am Kap Colonna war das Ostfränkische Reich so geschwächt, dass es im Juni 983 zu einem Slawenaufstand im Nordosten des Reichs kam. Die Bischofsitze Havelberg und Brandenburg wurden überfallen und zerstört. Ebenso beteiligten sich die Wikinger unter Harald Blauzahn am Aufstand und eroberten 983 das 974 an Otto II. verlorene Schleswig zurück.
Bistum Oldenburg „Starigard“
Nach meiner festen Überzeugung ist der in unserer Bardo-Urkunde genannte Bischof der Dänen „Staggo“ mit Bischof „Wago“ aus dem damaligen Bistum Oldenburg gleichzusetzen. Bischof Wago verschwand 983, in der Zeit des Slawenaufstands, spurlos aus seinem Bistum, ohne dass sein Tod irgendwo verzeichnet worden wäre. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Übertragungsfehler, der durch mündliche Überlieferung entstanden ist. Das erst um 970 von Otto dem Großen gegründete Bistum Oldenburg hieß nämlich zur damaligen Zeit „Starigard“ was alte Burg bedeutet. Außerdem hießen die dort ansässigen Abodriten „Wagrier“. Gut möglich, dass sich aus Wago, Wagrier und Starigard der Name „Staggo“ in der Überlieferung entwickelte.
Runenstein von Sonder Vissing
Außerdem wird „Staggo“ in unserer Urkunde aus 1043, als „Bischof der Dänen“ bezeichnet. Jedoch gab es zur damaligen Zeit keinen Bischof mit diesem Namen, auch nicht in den drei dänischen Bistümern Aarhus, Ribe und Schleswig. Nur eben Wago im Bistum Starigard. Und Wago hätte den Namenszusatz „Bischof der Dänen“ mehr als verdient. Wagos Schwester, Hodica, heiratete nämlich den slawischen Samtherrscher Mistiwoj und Mistiwojs Tochter, namens Tove, war nach dem Text des Runensteins von Sonder Vissing, die Frau von Harald Blauzahn.
Als die Slawen und Wikinger in 983 vor den Toren Starigards standen, wird ihm diese Verbindung jedoch nicht viel genutzt haben. Die Verbundenheit der Wikinger mit dem Christentum, war damals alles andere als gefestigt. Im Gegenteil, Kleriker wurden bei Gefangennahme geköpft, verbrannt, kastriert oder gevierteilt. Eine Flucht zu Willigis nach Mainz wäre für Wago oder „Staggo“ die weitaus bessere Alternative gewesen. Und das Willigis ihn, aufgrund seiner eigenen Abwesenheit und Unabkömmlichkeit im Jahr 985, hier im noch unerschlossenen Taunus, in Schloßborn, zum Bau einer Holzkirche nach nordischem Vorbild einsetzte, ist eine logische Konsequenz.
Bardo-Kirche (1043)
Wie schon gesagt, ließ Reichskanzler und Erzbischof Bardo das Geschehene in 1043 niederschreiben. Außerdem ließ er aber auch die Holzkirche des Willigis durch eine Steinkirche ersetzen. Und auch, dass er diese Steinkirche in Schloßborn persönlich einweihte, ließ er aufschreiben. Kurz zuvor, in 1036, hatte Bardo, und das verbindet ihn mit Willigis, den Mainzer Dom neu errichten lassen und auch diesen, in Anwesenheit von Heinrich III., persönlich geweiht.
Abtretungen des Schloßborner Sprengels
Nach vielen Fehden der Herren von Eppstein mit dem Hause Nassau kam es zu Beginn des 13. Jahrhunderts zu Abspaltungen der Schloßborner Einflusszone. Aus dem s.g. „Schloßborner Zehntregister“ von ca. 1230 geht hervor, dass folgende Orte noch Schloßborn zehntpflichtig waren:
Born, Mulinhusin, Nidhusin (Neidhausen), Aldenburch, Lenzigishagin (Lenzhahn), medietas ville superioris Selebach (halb Oberseelbach), Oberinhusin (Obernhausen), Niederinhusin medietas (halb Niedernhausen), Gospach villa superior (Oberjosbach), Ehlheldin medietas (halb Ehlhalten), Gospach villa inferior (Niederjosbach), Vockinhusin (Vockenhausen), Huselin (Hof Häusels), Frankenbruckin, Lubrechtesburnen.
Der nördlich gelegene Zipfel des Schloßborner Sprengels, hatte sich um diese Zeit, zu einer eigenen Herrschaft, mit der Burg Hattstein als Mittelpunkt, entwickelt.
Jürgen Grossmann und sein 1997 gefundener Münzschatz aus dem 13. Jhd.
Aus der Zeit, Ende des 13. Jahrhunderts, stammt ein, in unmittelbarer Nähe Schloßborns im Wald vergrabener Schatz, den Jürgen Großmann im Jahr 1997 finden konnte. Er bestand aus 8000 Silbermünzen, vornehmlich Brakteaten und Heller und war zum Zeitpunkt des Auffindens, der größte Mittelalter-Münzschatz Deutschlands.
Brakteaten
Professor Niklot Klüßendorf, Professor für Numismatik und Geldgeschichte, Uni.-Marburg, untersuchte den Fund und widmete ihm ein eigenes Kapitel in einem seiner Bücher. Er meinte, es könne sich um Gelder im Zusammenhang um die Königswahl Adolf von Nassaus handeln, der von 1292 bis 1298 römisch-deutscher König war.
Schloss von Born mit Wohnturm (1369)
Im Jahre 1369 legte Graf Eberhard I. von Eppstein ein festes Haus mit Turm und Verlies in Schloßborn an. Dieses als Jagdschloss benutzte Haus, gab dem Ort später seinen Namen „Schloßborn“. Im „Schloßborner Weistum“ von 1439 heißt es: „Daß ein Herr zu Eppstein Herr sei über Born, über das Haupt, über Dieb und Diebin, über Wunen (Wunden), über Wildschaden, über Wasser und Weide, über alle ungerechte Gewalt, und hat zu Born zu binden und zu entbinden, und Gebot zu machen. Item, wer gegen Born kommt und daselbst sitzt und wohnet Jahr und Tag ohne Nachfolger, der gehört dem Herrn zu Eppstein. Item, daß ein Herr zu Eppstein daselbst soll haben 30 Säcke Futterhaber, 13 Gulden Maibede und 13 Gulden Herbstbede.“
Ringmauer (1442)
Da Schloßborn jetzt unter alleiniger Oberherrschaft der Eppsteiner stand, wurde 1442 der gesamte Ort (Marx schreibt: nach römischer Art) befestigt. Rings um den Ort wurde eine 700 m lange, 7 Meter hohe Ringmauer mit 7, je 16,5 m hohen Wehrtürmen, errichtet. Zusätzlich einen Graben mit Wall und Hainbuchenhecken um die Mauer herum angelegt. Der von der Ringmauer umschlossene Raum barg außer den Burggebäuden mit ihren Stallungen und der Zehntscheune, schätzungsweise noch 40 bis 50 Behausungen, womit wir von einer Einwohnerschaft von 200 bis 250 Personen ausgehen können.
Das Haupteingangstor befand sich in der heutigen Langstraße, unterhalb des letzten, heute noch stehenden Turmstumpfes in der Grabenstraße. Weitere, kleinere Tore befanden sich in der heutigen Grabenstraße und nur für die Herrschaft zugänglich, in Richtung damaligem See, am heutigen Ginsterweg. Der See soll lt. Marx etwa 125 m lang und 100 m breit gewesen sein, also das heutige Gelände Caromber Platz und Freischwimmbad überragt haben. Es sollen dort ein Kahn vorhanden gewesen und sogar Sommerfeste gefeiert worden sein. Erst Mitte des 19. Jhd. wurde der See trockengelegt.
Als Abtrennung der Herrschaft von der gemeinen Bevölkerung, die meist aus Leibeigenen bestand, und zum Schutz der Zehnteinnahmen, diente eine innere Ringmauer, die nur durch ein bewachtes Tor in der heutigen Burgstraße durchschritten werden konnte.
Die Erbauer der Ringmauer orientierten sich beim Bau am schon vorhandenen Jagdschloss, welches wahrscheinlich sogar in die Ringmauer integriert wurde, sowie an der Ausrichtung der Bardo-Kirche von 1043, indem sie dieses Bauwerk, was ja zur Zeit des Ringmauerbaus schon 400 Jahre stand, im rechten Winkel, mit großzügigem Abstand, umbauten. Anders als die heutige Kirche von 1713, die Philippus und Jakobus geweiht ist, war die Bardo-Kirche nämlich dem heiligen Andreas geweiht und damit in ihrer Ost-West Achse verschieden zur heutigen Kirche ausgerichtet.
Schützenhof
Interessant ist auch, dass es aus dieser Zeit, neben dem mehrmals umgebauten Jagdschloss in der Burgstraße, noch mehrere Häuser geben soll, die heute noch stehen. Z.B. gilt der „Schützenhof“ als ältestes Gebäude Schloßborns. Ein Dachbalken auf der südlichen Giebelseite, bezeugt für ihn das Jahr 1351 als Baujahr.
Ludwig zu Stolberg
Noch zu Lebzeiten des letzten Eppsteiner Herrschers, des kinderlos gebliebenen Eberhard IV., wurde Ludwig zu Stolberg, ein Neffe Eberhards, als 9-jähriger zu seinem Onkel nach Eppstein zur Erziehung und Nachfolge entsendet. Bereits als 16-jähriger, im Jahr 1521, wurde er an die Universität von Wittenberg geschickt, wo er mit Martin Luther und Philipp Melanchthon in Kontakt kam. Auch am Reichstag zu Worms, wo Luther seine 95 Thesen widerrufen sollte, habe er teilgenommen.
Nach dem Tod Eberhards 1535, hatte es Ludwig zu Stolberg anfänglich mit der Einführung des Protestantismus nicht eilig, jedoch unterstützte er aber bereits 1540 Bestrebungen des Kugelherrenstifts, einem Kloster in Königstein, sich auflösen zu dürfen, da die Mönche sich dem Protestantismus zugewandt hatten.
Für Schloßborn wird bereits 1554 ein protestantischer Pfarrer, namens Tilemannus Wenzell erwähnt. Und ab den 1560er Jahren soll der neue Glaube dann flächendeckend in Königstein und Eppstein eingeführt worden sein. Etwa zeitgleich, in 1564, hatte Kaiser Maximilian II. Schloßborn zum Flecken, also zum Mittelzentrum für alle umliegenden Dörfer, erhoben, was mit Verleihung von Marktrecht und der Einführung einer ersten Schule einherging.
Mit der Einführung des Protestantismus sollen die Schloßborner, zumindest anfänglich, nicht besonders glücklich gewesen sein. So schreibt Marx: „Nur schwer und rein äußerlich nahmen die Bewohner von Born den ihnen aufgezwungenen Glauben an, innerlich hielten sie noch immer an ihrem alten fest. Heimlich suchten sie Orte auf, wo noch katholische Priester wirkten, wie in Camberg, Höchst usw., doch setzten sie sich hierbei großer Gefahr aus, denn sie wurden in dieser Hinsicht sehr streng überwacht. Es wurden Visitationen darüber angeordnet, ob die Untertanen nicht heimlich irgendwo am katholischen Gottesdienst teilnehmen und die bei diesen Visitationen zu beantwortenden Fragen, in 20 Artikeln (die s.g. Mecklenburger Artikel) zusammengestellt. Dem Schultheißen und Gericht zu Born wurden unter Androhung schwerer Strafen und Landesausweisung folgende Fragen vorgelegt:
>> Wie es mit den Begräbnissen und Taufen gehalten wird, ob die Kinder nicht an anderen Orten getauft würden von päpstlichen Pfaffen? Wie es mit den Trauungen gehalten, ob sie heimlich oder an anderen Orten geschlossen würden? Weiter, ob sie (die Bewohner) am Fronleichnamsfeste gegen Camberg, Höchst oder anderswo hingingen, wo Papst-Greuel getrieben wird? Ob die Einwohner in guter Zeit nicht zum Nachtmahl gegangen sind und von wem die Kirchenpersonen unterhalten werden?<<
Erzbischof Daniel von Brendel
Als Ludwig zu Stolberg 1574 starb, ging sein Besitz an seinen Bruder, Christoph zu Stolberg über, der allerdings auch schon 1581 kinderlos verstarb. Jetzt erhob der katholische Kurfürst und Erzbischof Daniel von Brendel Anspruch auf Königstein und Eppstein und bekam die Städte und Ländereien, samt dem Flecken Schloßborn zurück. Doch mit der Gegenreformation ließen sich die neuen Herren wieder Zeit und warteten wohl, bis die protestantischen Pfarrer von selbst ausstarben. Für das Jahr 1596 jedenfalls, ist für Schloßborn immer noch der protestantische Pfarrer Wenzell schriftlich festgehalten, und zwar zusammen mit seiner Frau Maria und deren Tochter Walper (Walburga). Die Urkunde besagt, dass Walper am 21.9.1596 den Lehrer Henrich Hirdes, geboren in Eppstein, heiratete und Hirdes eine Pfarrstelle in Oberauroff annahm.
Hexenverbrennung
Für den Herbst 1596 ist eine weitere Begebenheit, Schloßborn betreffend, überliefert. Nach dem Tod des Schloßborner Schultheißen (wahrscheinlich Petter Emmerich, der 1584 urkundlich noch als Schultheiß tätig war), werden dessen Frau und Tochter, vom Königsteiner Oberamtmann Gernand von Schwalbach, verhaftet und der Hexerei bezichtigt. Als der Amtmann von Eppstein, Jacob von Othera, erfährt, dass die Frauen nach Königstein verbracht und dort peinlich befragt, also gefoltert wurden, legt er Einspruch beim Kurfürsten und Erzbischof von Mainz ein, der ihm bestätigt, dass für Schloßborn, das zu Eppstein gehörige Halsgericht am Hof Häusels zuständig sei. Der Königsteiner Oberamtmann Gernand von Schwalbach nimmt das Schreiben zur Kenntnis, fährt aber ungeniert mit der peinlichen Befragung fort. Gernand von Schwalbach fungierte als Ankläger und Richter in einer Person und ließ beide Frauen im Januar 1597 auf dem Scheiterhaufen in Königstein verbrennen. Über das Schicksal einer dritten Frau aus Schloßborn, die ebenfalls verhaftet wurde, ist leider nichts weiter bekannt.
Erzbischof Johann Schweikhard von Kronberg
Erst unter dem neuen Erzbischof Johann Schweikhard von Kronberg wurde die Rekatholisierung in Schloßborn vollendet und unter dem neuen Pfarrer Johannes Locher, am 19. Dezember 1604, erstmals wieder katholischer Gottesdienst gefeiert. Hierzu waren nicht nur die Schloßborner, sondern ebenso die Einwohner Ober- und Niederjosbachs, Ehlhaltens und Lenzhahns geladen. Es bleibt noch zu erwähnen, dass dieser Gottesdienst immer noch, in der damals schon fast 600 Jahre alten Bardo-Kirche Schloßborns, stattgefunden hat.
Marquis von Spinola
Als der 30-jährige Krieg in 1618 begann, war Schloßborn also wieder katholisch und die ersten negativen Ereignisse, die man für unsere Region damit verband, waren, dass im Jahr 1620 die katholischen Truppen des Marquis von Spinola, mit über 2000 spanischen und flandrischen Söldnern, Eppstein und Neuenhain ausplünderten. Doch warum gerade Eppstein und Neuenhain? Nun, aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, hatten Eppsteins Herren bereits 1492, einen Teil der Burg Eppstein an die Landgrafschaft Hessen verkauft. Dieser Teil ging 1567 an die Linie Hessen-Marburg und nach deren Aussterben 1604 an Moritz von Hessen-Kassel, einen Protestanten, der sich und seine Ländereien dem noch strengeren Calvinismus verschrieben hatte. Die Wachmannschaft von etwa 200 protestantischen Soldaten ergab sich 1620 dem anrückenden Spinola, weshalb Eppstein geschont, nur geplündert, aber nicht niedergebrannt wurde.
Friedrich V., der Winterkönig
Bei Neuenhain verhielt es sich ähnlich. Das Dorf war 1581, nach dem Ende der Stolberger Herren, an die Kurpfalz von Friedrich IV. gefallen, dessen Sohn Friedrich V., genannt der Winterkönig – da er nur einen Winter lang regierte, sich 1619 zum protestantischen König von Böhmen ausrufen lassen ließ. Neuenhain war damit ebenfalls protestantisch/calvinistisch geworden und wurde geplündert. Alles nach dem Grundsatz „Cuius regio, eius religio“, wessen Gebiet, dessen Religion.
Gustav II. Adolf von Schweden
1622 kamen dann erstmals protestantische Truppen unter Herzog Christian von Braunschweig in unsere Gegend. Von der Wetterau herkommend, zog er mit seinem 12.000 Mann starken Heer über Oberursel, Eschborn und Sulzbach. Diese Städte wurden dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Er wollt in Höchst den Main überqueren und sich bei Darmstadt mit anderen protestantischen Truppen vereinen, was ihm aber wegen des starken Widerstands der Höchster Einwohner und den katholischen Truppen Tillys nur unter sehr starken Verlusten gelang. Die Festung Königstein hatte vorsorglich ihre Kanonen in Stellung gebracht, sodass Christian von Braunschweig von einem Angriff auf die Stadt absah.
Über die Auswirkungen der ersten Hälfte des 30-jährigen Krieges auf Schloßborn, ist so gut wie nichts bekannt. Nur dass die Jahre 1628 und ´29 ausgesprochene Hungerjahre gewesen sein sollen. Schloßborn scheint wohl erst im Winter 1631, übrigens genau wie Königstein, direkt von Kampfhandlungen betroffen gewesen zu sein. Die Truppen des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf von Schweden und seines Verbündeten, Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassel eroberten die Burgen Reifenberg, Falkenstein und Kronberg im Handstreich, während Königstein noch Widerstand leistete. Doch nach dem Fall von Mainz am 23. Dezember 1631 ergab sich am 24. Dezember auch die Festung Königstein.
Dass der Flecken Schloßborn davon direkt betroffen war, steht nirgends geschrieben, es ist aber davon auszugehen. Altbürgermeister Marx schreibt jedenfalls in seiner Chronik, leider ohne Quellenangabe: „Im 30-jährigen Krieg hat Born schwer gelitten, hauptsächlich unter den Schweden. In den wechselvollen Kämpfen fiel Born und Umgebung in 1631 an die Grafen Stolberg zurück, welche es in 1636 wieder an Churmainz verloren. Beim Friedensschluss am 29. Oktober 1648 hatte Born nur noch 11 Familien, die Befestigung war größtenteils zerstört, viele Gebäude niedergebrannt und alles bewegliche Gut geraubt.“
Pest
Nach dem 30-jährigen Krieg erreichte uns dann, von Holland den Rhein herauf-kommend, über Mainz, Höchst und Frankfurt in den Jahren 1665 bis 1667 der schwarze Tod. Alle alten Akten, auch die Pfarrbücher sollen damals aus Angst vor Ansteckung verbrannt worden sein. Das geängstigte Volk verfiel dem Wahnsinn und allerlei abergläubigen Ideen. Selbst die ekligsten Mittel wurden, wenn sie empfohlen waren, in der Furcht vor dem Würgeengel angewandt. So wurde z.B. der Urin vom Ziegenbock getrunken. Da auch Fröhlichkeit als krankheitshindernd empfohlen war, tanzten Manche, die bereits den Keim des Todes trugen, in irgendeinem ulkigen Kostüm oder mit einem Musik- oder Klapperinstrument singend durch die Straßen, bis sie vielleicht schon bald in irgendeiner Ecke liegen blieben. In 1668 hatte Schloßborn noch 104 Einwohner, 15 Männer, 19 Weiber, 42 Söhne und 28 Töchter. Und dabei erging es Schloßborn noch gut. Viele umliegende Ortschaften wurden damals komplett entvölkert und zur Wüstung.
3. Schloßborner Kirche (Von Schönborn-Kirche)
Nachdem die Pest überwunden war, füllte sich Schloßborn schnell mit Bewohnern anderer Dörfer, die zu Wüstungen geworden waren. Die jetzt schon fast 700 Jahre alte Bardo-Kirche wurde zu klein. Dazu trug auch die Tatsache bei, dass etwa 3 Km nördlich Schloßborns, 1684, ein neues Dorf, namens Glashütten entstand, deren Bewohner unsere Kirche nutzten.
Schloßborn war zu diesem Zeitpunkt schon 700 Jahre alt, Flecken und Mittelzentrum. Klar, dass man das, was da unweit des eigenen Ortes, quasi im eigenen Wald, aus einer ehemaligen Glasherstellung, auf einer gerodeten Fläche entstand, mit argwöhnischem Blick verfolgte. So kam es auch laut Marx immer wieder zu Reibereien und das soll dazu geführt haben, dass sich die Glashüttener weigerten, sich am Kirchenbau in 1713 in Schloßborn zu beteiligen. Wobei man sagen muss, dass die Glashüttener von 1684 bis 1713, also etwa 30 Jahre lang, die alte Schloßborner Bardo-Kirche von 1043 mitgenutzt hatten. Sie besuchten in Schloßborn die Gottesdienste, ließen sich hier taufen, heirateten hier und wurden sogar hier beerdigt.
Lothar Franz von Schönborn
Erzbischof Lothar Franz von Schönborn, der berühmte barocke Baumeister, der das mit Versailles vergleichbare Lustschloss „Favorite“ in Mainz oder Schloss Weißenstein in Pommersfelden bauen ließ, gab also die 3. Schloßborner Kirche ab dem Jahr 1712 in Auftrag, welche 1713 bis auf Innenausstattung und Turm fertiggestellt war. 1714 folgte die Fertigstellung des Hochaltars, den Lothar Franz von Schönborn in Schloßborn persönlich weihte. 1715 erfolgte dann noch die Fertigstellung des Turms, über dessen Haupteingang, auch heute noch, das Wappen Lothar Franz von Schönborns prangt.
Kirchenstreit
Die Glashüttener aber weigerten sie sich mitzuarbeiten oder einen Ausgleich zu zahlen, obwohl sie durch das Vikariat in Mainz und das Oberamt in Königstein zu diesen Diensten verpflichtet und aufgefordert worden waren. Sie gaben an, eine eigene Kirche bauen zu wollen. Die Schloßborner verrichteten also alle Fronarbeiten alleine, verklagten die Glashüttener vor Gericht und die Streitigkeiten wurden immer schärfer. Die Glashüttener hingegen klagten darüber, dass sie von nun an Geld für bestimmte kirchliche Leistungen wie z.B. die Taufe bezahlen mussten, währenddessen die Schloßborner Kinder kostenlos getauft wurden.
Auch habe der Schultheiß von Schloßborn durch 9 bis 10 versteckte Männer, den Glashüttener Gläubigen, welche nach Born in die Kirche gehen wollten, die Hüte wegnehmen lassen, sodass sie bloßköpfig zum Gottesdienst gehen mussten, ferner habe der Pfarrer den Glashüttnern bei Strafe das Betreten der Kirche verboten und Wachen bei derselben aufgestellt. Ebenso habe der Schultheiß von Schloßborn sonntags die Fleckentore sperren lassen, um so den Glashüttenern den Zugang zur Kirche unmöglich zu machen. Vor Gericht gaben sowohl der Pfarrer als auch der Schultheiß die obengenannten Darstellungen zu, verwiesen aber auch darauf, dass die Glashüttener verbotenerweise einen Pfad durch ein neu bestelltes Feld gegangen wären und das, zum wiederholten Male, trotz Unterlassungsaufforderung. Der Glashüttener Schultheiß sei sogar vorausgegangen und hätte seine Bürger aufgefordert, ihm zu folgen.
Lange Rede kurzer Sinn: Die Glashüttener wurden sowohl vom Vikariat als auch vom Oberamt per Dekret zur Ableistung von Fronden, zu der neuen Schloßborner Kirche, für schuldig erklärt. Die Glashüttener erklärten sich auch grundsätzlich zu einer Ausgleichszahlung von 50 Gulden bereit. Die Schloßborner sahen das Angebot für unbillig an und rechneten hingegen vor, dass sie für den Kirchenbau, ohne den Turm, 1638 Gulden bezahlt hätten und wollten lieber gar nichts haben als das, und dafür lieber von den Glashüttnern separiert werden.
Insgesamt betrugen die Kosten für die Errichtung der Schloßborner Kirche 2781 Gulden. Glashütten wurde zur Zahlung von 500 Gulden verurteilt, zahlte aber nicht. Danach erfolgte ein Vergleich, der folgendermaßen ausfiel:
„Die Glashüttener sollen, wenn sie bei ihrer Schloßborner-Mutterkirche bleiben wollen, 300 Gulden an Born zahlen oder 150 Gulden zahlen und für immer von der Borner Kirche getrennt sein.“
Die Glashüttener zahlten nicht und Freiherr von Bettendorf, Königsteiner Oberamtmann, verfügte am 21. März 1719 die Exekution, d.h. die Loslösung Glashüttens von der Schloßborner Mutter-Kirche. Daraufhin wurden 150 Gulden gezahlt.
Die Glashüttener, die mittlerweile ihre eigene kleine Kirche gebaut hatten, wurden nun von einem Pfarrer aus Seelenberg, Pater Wenzel, mitversorgt. Dieser wurde aber schon 1728 abberufen und nun musste Glashütten, mangels eigenem Pfarrer, wieder zur Pfarrei Schloßborn zurück und blieb dort auch bis in die 2000er Jahre, als Filiale der Kirche von Schloßborn.
Schinderhannes
Im Frühjahr 1800 wechselte der berüchtigte Schinderhannes, alias Johannes Bückler, auf die rechte Rheinseite. Linksrheinisch war es ihm zu heiß geworden. Einer seiner Raubkumpanen, Johann Martin Rinkert, stammte aus Schloßborn und hatte ihm wohl verraten, dass sich nahe Schloßborn eine Räuberunterkunft, namens Hasenmühle, befinden sollte. Wegen ihrer günstigen Lage direkt an einem Grenzbächlein, der Kurmainz von Nassau trennte, und auch wegen ihres unbedarften und loyalen Müllers, Andreas Kowald, der dem Schinderhannes stets wohlgesonnen war, diente ihm die Hasenmühle seit dieser Zeit als Unterschlupf und Versteck. Gegen Ende 1800 verbrachte er, zusammen mit seiner Liebschaft Juliane Blasius, sogar sieben Wochen am Stück auf der Hasenmühle. Müller Kowald wurde von ihm niemals bedroht, im Gegenteil, er wäre mit seinem Aufenthalt sehr zufrieden gewesen.
Nach einer Erzählung soll der Schinderhannes, ein eben geschlachtetes Schwein, welches ausgenommen und im Schloßborner Pfarrhof aufgehängt war, gestohlen haben. Am Abend veranstalteten die Gauner auf der Hasenmühle „Metzelsuppe“, wozu sie dem Schultheißen Frankenbach und dem Schullehrer Henninger aus Schloßborn, Einladungen schickten. Pfarrer Santlus soll hingegen nicht eingeladen worden sein.
In der Neujahrsnacht 1800 auf 1801 soll Bückler, von der Hasenmühle kommend, auf dem damals noch vorhandenen zugefrorenen See (heute Caromber Platz) ins Eis eingebrochen sein. Anschließend hätte er sich zum Aufwärmen in die nahegelegene Wirtschaft, die sich im alten Schlossgebäude befand, begeben und dort noch einen Streit seiner Kameraden um ein Mädchen geschlichtet. Überall in der gesamten Umgebung wurden die Einwohner Schloßborns, wohl nicht ganz unbegründet, später scherzhaft als „die Schinderhannese“ bezeichnet.
Kurz vor seinem wohl berühmtesten Coup, dem Postraub von Würges, am 10. Januar 1801, schrieb Bückler einer Erpresserbrief an den Besitzer der benachbarten Fuchsmühle, Conrad Sparwasser:
„Sparwasser, Spitzbub. Ir lüffert mürr biß morje Owend 11 Uhr an die Aich am Börner Weg ain Axt, ain Häbeiße, ain groß Laib Brot, ain Schünke un ain Krugk Schnaps. Mürr san vill Kerle unn der Zahnfranz, der Husarefritz unn der scheel Hannes iß aach bei mürr. Wenn ir nütt den rote Gückel uff de Müll hun wollt, warne ich Euch. Der Zahnfranz hat gedrat, et tät, wenn i den schnaps net bringt, alles verschieße, was aus der Müll herauskem. Mürr brauche vill Geld un han kaans, die Jule will ir Kostgeld unn naie Kleider hun, drum mache mürr hin wo vill Geldt iß, noch Heftrich unn Esch unn weiters, unn wann döß Zeig nit morje Owend do iß unn kaner dorbey, derß gitt unn sachts, obs in Heftrich sauer iß unn der scholtes dehaam, sein ich for nix gut unn aier Lewe: Hallts Maul unn sach dem steife Pitter nix, der platschts sonst. Ir Spitzbube unn Wilbertschneußer. Mürr sein ehrliche Leit. Wannß aich aier Lewe lib iß, warn aich nochmals, Hallt Baroll. Johannes dorch den Wald“
Beim Postraub, der zusammen mit der berüchtigten Niederländerbande des Räuberhauptmanns Picart durchgeführt wurde, ging man äußerst brutal vor. Es kam zu schweren Misshandlungen der Opfer und die Beute war so groß, dass die Fahndungsmaßnahmen der Behörden nun drastisch verstärkt wurden. Im Mai 1802 wurde er dann bei Wolfenhausen aufgegriffen. Die Verschleierung seiner Identität nutzte ihm nichts, da er nach Limburg gebracht wurde, wo ihn einer seiner ehemaligen Gesellen verriet. Er wurde dann über Frankfurt nach Mainz gebracht, verurteilt und dort am 21. November 1803, zusammen mit 19 seiner Gefährten, vor 30 bis 40 000 Schaulustigen, der Guillotine zugeführt.
1. Weltkrieg
Die sehr harten Waffenstillstandsvereinbarungen nach dem ersten Weltkrieg sahen vor, dass in unserem Gebiet, rechts des Rheins, ein Brückenkopf der Franzosen eingerichtet wurde. Er reichte von Mainz bis tief in den Taunus. Alle innerhalb dieser Grenze unterstanden der Besatzungsmacht. Die Grenze des hiesigen Brückenkopfs lief so, dass Seelenberg, Nieder- und Oberreifenberg, Falkenstein, Kronberg, Schönberg und Oberhöchstadt noch innerhalb des besetzten Gebietes lagen. Die Grenze wurde streng geschlossen, aller Verkehr unterbunden und der Sitz der Verwaltung nach Königstein verlegt. Der Königsteiner Bürgermeister zum provisorischen Landrat ernannt.
Nach einem Besuch einiger französischer Offiziere bei unserem stellvertretenden Bürgermeister Franz Becht, machten diese sich auf die Rückfahrt nach Mainz. Kurz unterhalb der ersten scharfen Kurve in Richtung Ehlhalten, sahen die Offiziere eine aufrechtstehende scharfe 7,5 cm Granate mitten auf der Fahrbahn. Sie wendeten sofort und brachten den stellvertr. Bürgermeister in schwere Erklärungsnot, da sie ein Attentat vermuteten. Bei der noch in der Nacht durchgeführten, strengen Untersuchung, stellte sich heraus, dass ein hiesiger Junge am Vortag, für seine schwerkranke Mutter, in Eppstein Medizin kaufen sollte und auf dem Rückweg eine von deutschen Truppen weggeworfene Granate gefunden hatte und diese, nichts Böses im Schilde führend, auf der Fahrbahn platzierte. Gottseidank erkannten die Franzosen den Vorfall als „Dummerjungenstreich“ an. Der Wald wurde an dieser Stelle durchsucht, zahlreiche weitere Granaten entdeckt und nahe bei der Kurve vergraben.
Schloßborn um 1920
Marx schildert eine weitere kritische Situation: Am Nachmittag des 27. Juni 1919 sollte die deutsche Regierung, den ihr vorgegebenen Friedensvertrag (Versailler-Vertrag) unterzeichnen, andernfalls der Waffenstillstand aufgehoben und der Kriegszustand wiederhergestellt sein. Bereits am Vormittag war die hiesige Besatzung unter Mitnahme sämtlicher Pferdefuhrwerke nach dem Cröfteler-Feld abgerückt, um möglichst nahe an der vorgesehenen Angriffs-Gefechtslinie zu sein. Überall waren schon besondere Brandkommandos zur Vernichtung von allem Hab und Gut aufgestellt. Die Entscheidung rückte immer näher und man fürchtete schon den ersten Kanonenschuss, da kehrten die Truppen mit Musik und Gesang hierher zurück, die Gewehre mit Blumen und grünen Zweigen geschmückt. Freundlich wie nie zuvor riefen sie, soweit sie unsere Sprache beherrschten: „Deutschland unterschreibt“.
2. Weltkrieg
Bevor wir jetzt mit dem 2. Weltkrieg fortfahren, möchte ich feststellen, dass Altbürgermeister Marx Mitglied der NSDAP war, er das auch offen und ohne Umschweife zugab, jedoch wehrte er sich gegen die Behauptung, dass dies freiwillig geschehen war. Er verwies auf den Zwang und die Notwendigkeit Mitglied der Partei gewesen zu sein, um das Amt des Bürgermeisters, das er ja schon 1908 bis 1919 und weiter ab 1924 innehatte, ausführen zu können. Auch sind aus dieser dunklen Zeit keine Verfehlungen oder menschenverachtende Handlungen, Verfolgungen oder Misshandlungen z.B. auch der in seiner Chronik beschriebenen Kriegsgefangenen, bekannt. Vielmehr verhinderte Marx, durch sein umsichtiges Handeln in den letzten Kriegstagen, durch die Anweisung zum frühzeitigen Entfernen der Panzersperren und nationalsozialistischen Straßenschildern und durch sein beherztes, für sein eigenes Leben bedrohliches Eingreifen, dass Schloßborn und ganz besonders einem bestimmten Einwohner, Schaden zugefügt wurde. Die Schloßborner dankten es ihm, durch ihr bedrohliches Auftreten gegenüber einem Erschießungskommando. Marx schreibt zu dem Vorfall recht bescheiden:
Er selbst sei in eine äußerst gefährliche Situation geraten, als er wegen Duldung der Zerstörung der in Frage stehenden Straßenschilder von einer Feldgendarmerie-abteilung zur Rechenschaft gezogen wurde, denn das „Umlegen“, war in jenen Tagen stark in Übung.
Die Augenzeugin Helma Mayer, Jahrgang 1931, mit der ich ein Interview führte, schildert den Vorfall etwas ausführlicher:
„Als Herr Joseph Conrady gerade dabei war, die Straßenschilder der Adolf-Hitler-Straße und der Göringstraße abzuschrauben, kamen zufällig Feldgendarmen vom Buhleser Weg [Ehlhaltener Straße] her ins Dorf. Diese erfassten sofort die „wehrkraftzersetzende“ Situation und stellten Herrn Conrady zur Rede, natürlich mit der Androhung ihn sofort an die Wand zu stellen und zu erschießen. Frau Katharina Mohr, genannt „Becke-Kettel“, Ehefrau des Josef Mohr, die in der Nähe wohnte, rannte aus ihrem Haus und schrie den Soldaten, die ihre Gewehre schon im Anschlag hatten, entgegen: „Seid ihr verrückt? Der Mann hat Fraa un Kinner un seht ihr dann nit, dass der Kriesch fast aus is?“ Viele Einwohner und auch der Bürgermeister Marx eilten herbei, woraufhin auch der Bürgermeister in Bedrängnis geriet und ebenfalls erschossen werden sollte. Doch die Menschenmenge stellte sich dem Erschießungskommando entschlossen entgegen und so wurde erreicht, dass die Feldgendarmen nur die Personalien der Beschuldigten aufnahmen und dann unerledigter Dinge abzogen. Als ich zurück in unser Haus kam, sah ich meinen Vater, Johann Melchior Schmitt, in unserer Küche stehen, sein Gewehr durch das Oberlicht des Fensters geschoben. Er sah mich an und sagte: „Die hätten hier niemanden erschossen!“ Später meinte er, er hätte Warnschüsse abgeben wollen, falls es zum Äußersten gekommen wäre.“
Und auch die Kirchenchronik gibt unabhängig davon eine ähnliche Auskunft: So schreibt Pfarrer Sturm:
„Inzwischen räumten die Einwohner die angelegten Panzersperren weg. Ein aufregender Zwischenfall spielte sich am Mittwoch ab. Ein Einwohner machte sich daran, das Straßenschild Adolf Hitlerstraße zu entfernen, wurde dabei von einer Streife der Feldgendarmen gestellt. Daraufhin sollte der Bürgermeister Marx standrechtlich erschossen werden, was nur durch die drohende Haltung der Einwohner Schloßborns verhindert wurde.“
Haus Marienruhe
Das Gelände auf dem das Haus Marienruhe und der heutige Kindergarten stehen, wurde 1928, durch zwei Geschwister der Schloßborner Familie Klomann, der Kirchengemeinde gestiftet. Diese baute daraufhin, mit viel Eigenleistung Schloßborner Bürger, das Haus Marienruhe und richtete in ihm u.a. den ersten Kindergarten Schloßborns ein. Im Jahr 1941 beschlagnahmten die Nationalsozialisten das Haus, hängten alle Kreuze ab, entließen alle katholischen Kindergarten-schwestern und setzten eine linientreue Erzieherin der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt NSV ein. Die katholische Kirchengemeinde protestierte scharf gegen diese Enteignung, doch ohne Erfolg. Laut der Augenzeugin Helma Mayer schickten daraufhin die Schloßborner Familien, bis Kriegsende, ihre Kinder nicht mehr in den Kindergarten. Für mich ein bewundernswerter Akt des zivilen Ungehorsams.
Attentat vom 20. Juli 1944
Zum Attentat vom 20. Juli 1944 schreibt Marx in seiner Chronik:
„Selbst der einfachste Mensch sieht ein, dass der Krieg für Deutschland unfehlbar verloren geht. Aber die Reichsregierung will sich nicht entschließen, den sinnlos gewordenen Kampf aufzugeben. Einige weitschauende Männer versuchten daher am 20. Juli den Führer des Reichs durch einen Sprengstoffanschlag aus dem Weg zu räumen. Durch einen unglücklichen Zufall misslingt jedoch das Attentat.“
Schloßborn ist zu verlassen!
Über einen Befehl, kurz vor Ende des Krieges an alle Einwohner, Schloßborn zu verlassen, schreibt Marx:
„Wir Einwohner von Schloßborn sind uns klar darüber, dass das Verlassen von Haus und Hof unseren Untergang bedeutet, denn nach den Beobachtungen im linken Rheinland, nehmen die SS-Truppen von den verlassenen Dörfern Besitz, schlachten alles Vieh ab, führen ein Schwelgerleben und stecken dann alles beim Herannahen des Feindes in Brand, während die vertriebenen Bewohner auf den Landstraßen vor Hunger sterben. Wie immer bei gemeinschaftlicher Not, fühlen sich auch an diesem Schreckenstage alle Schloßborner solidarisch. Einmütig beschließen wir, unser Dorf nicht zu verlassen, komme was wolle, zumal die hier einquartierten Soldaten auch noch da sind und unsere Absicht voll und ganz unterstützen. Gegen Abend kehrten dann auch die schon vorher einberufenen Volkssturmmänner nach Schloßborn zurück, da deren Befehlshaber am Sammelplatz nicht erschienen ist, sich wohl abgesetzt hat. Dieses Gerücht bestärkt uns erst recht in dem Willen, die wahnsinnigen Befehle der Parteileitung zu sabotieren und im Vorgefühl der bevorstehenden Erlösung von der Parteityrannei, feiern die Volkssturmmänner, nach der kurzen Abwesenheit, recht lange die glückliche Wiederkehr.
Über Hitler schreibt Marx:
„Der Führer des deutschen Reiches, der die alleinige Befehlsgewalt über die gesamte deutsche Streitmacht an sich gerissen hat und in brutaler Weise jeden edelgesinnten Menschen, welcher sich erlaubt, ihm von der Fortführung des Krieges abzuraten, beiseiteschaffen lässt, ist nicht bereit, vor den, zu Lande, zu Wasser und in der Luft haushoch überlegenen Gegnern, zu kapitulieren und damit der uferlosen Vernichtung von Menschenleben und Sachwerten ein Ende zu setzen. Im Gegenteil, jetzt wo er den von ihm angezettelten Krieg nicht mehr gewinnen kann, ist er offenbar selbst entschlossen, das ganze deutsche Volk samt seinem Eigentum zu vernichten, damit der Feind nur noch ein „schlafendes“ Deutschland antreffe, wie er sich ausdrückte.“
Marx schreibt noch über viele Fliegerangriffe in unserer Gegend, über zahlreiche Abwürfe von Spreng- und Brandbomben auf Schloßborn und seine Wälder, über die Angst der Bevölkerung vor direkten Treffern, über Luftkämpfe und abgestürzte Bomber und Jagdflugzeuge in unserer Gemarkung. Ein Flugzeug zerschellte am Schusterberg, eines in der Frankenlach und eines stürzte in den Kirschenseyen. Für mich war das erschreckend, aber auch aufschlussreich und informativ. Ich bin aber sehr froh, dass man in vielen Absätzen spürt, welche Ablehnung Marx dem Nazi-Regime entgegenbrachte.
Neubaugebiete
Für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg bleibt zu berichten, dass Schloßborn etwa 300 Vertriebene (Glashütten etwa 100) aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten aufgenommen hat. Viele Nachkommen dieser Familien gingen dann mit mir zusammen in die Schule. Durch diesen enormen Zuzug, kam es in den 50er, 60er und 70er Jahren zu einem Bauboom. Die Kirche von 1713 war viel zu klein geworden und wurde von 1955 bis ´58 um das Doppelte vergrößert. Drei große Baugebiete wurden ausgewiesen, Im Seyen, Im Weiherfeld und am Dattenberg, was heute über dem Seegrund heißt. Die Gemeinde Schloßborn ließ zur ausreichenden Wasserversorgung, 1963 einen Hochbehälter bauen, für kulturelle und sportliche Veranstaltungen die Mehrzweckhalle errichten, einen den neuesten Standards entsprechenden Fußballplatz anlegen und das Schwimmbad von Grund auf umbauen und renovieren. Weiterhin war geplant, Schloßborn nach Glashütten hin zu erweitern und den Ort mit einer Ringstraße, die den Namen auch verdient hätte, zu umschließen. Leider wurden viele sinnvollen Aktivitäten durch die Zwangseingemeindung 1972 abrupt unterbrochen und kamen nicht mehr zur Ausführung.
Auflösung der Gemeinde Schloßborn im August 1972
Anfang August 1972 wurde per Gesetz im Hessischen Landtag mit den Stimmen der regierenden SPD-FDP Koalition, gegen die Stimmen der CDU Opposition, die 1000-jährige Gemeinde Schloßborn aufgelöst und in die damals neu geschaffene Gemeinde Glashütten eingegliedert.
Eine Petition, unterschrieben von allen damals führenden Schloßborner Würdenträgern, die sich u.a. auf ein Gutachten des Leiters des Hessischen Hauptstaatsarchivs, Herrn Dr. Struck, beriefen, wurde ignoriert. Ebenso das Gutachten selbst, welches von der Stelle erstellt worden war, die der Hessische Landtag extra im Falle von Namensstreitigkeiten zwischen Ortschaften, eingerichtet hatte. Herr Dr. Struck schrieb eindeutig und über jeden Zweifel erhaben, dass ein Zusammenschluss der Ortschaften Glashütten, Oberems und Schloßborn nur einen Namen tragen könne, nämlich GEMEINDE SCHLOSSBORN!
Christoph Klomann, Februar 2025